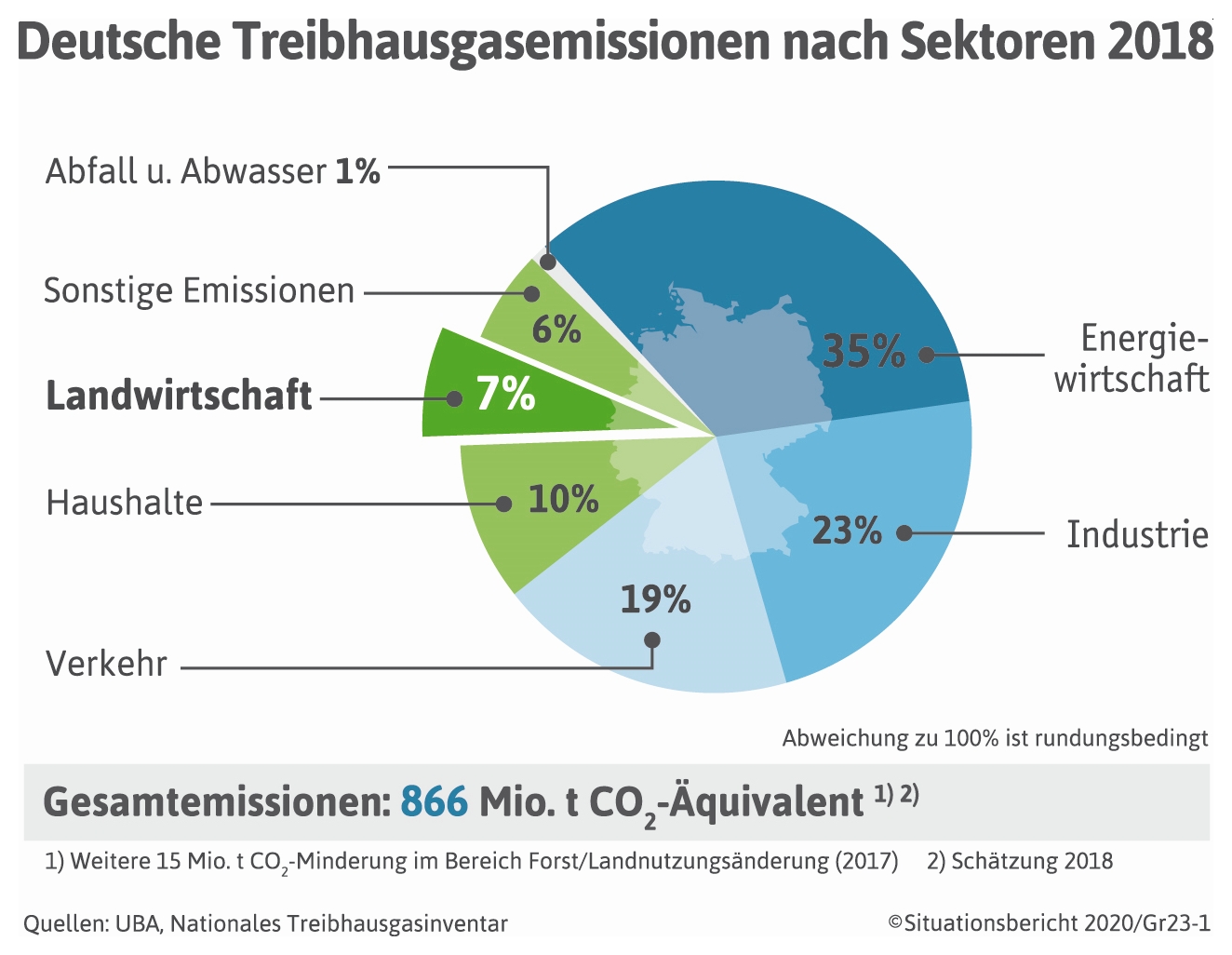Energie aus erneuerbare Energien, moderne Stalltechnik, verbesserte CO2-Speicherung durch humusreichere Böden oder den Weidegang der Kühe: Es gibt viele Aktivitäten, mit denen Milchbauern die Klimabilanz schon heute verbessern.

Wir bayerischen Milchbauern haben die Zukunft im Blick.

Sonnenstrom senkt CO2-Ausstoß
Für das Klima ist es eine ausgezeichnete Nachricht, dass auf den Dächern von Bayerns Bauernhöfen beeindruckend viele Sonnenkollektoren installiert sind. Schließlich sollen Erneuerbare Energien bis 2030 – also bereits in acht Jahren - 80 Prozent des deutschen Energiebedarfs decken. Für Milchbauern, die für ihre Melkanlagen und die Kühlung der Milch viel Strom benötigen, senkt der Strom aus der Sonne spürbar die Betriebskosten. Fachleute wie der Klimabauer Franz-Xaver Demmel (siehe auch Schwerpunktthema in der GUAD!#08) rechnen fest damit, dass die Landwirtschaft in Zukunft neben der Erzeugung von Lebensmitteln eine wichtige Rolle als Produzent regenerativer Energien spielen wird.
Maschinen, die Sonne tanken
Selbst große Traktoren werden in Zukunft Strom statt Diesel tanken können. Landwirtschaftliche Maschinen mit Elektroantrieb stehen kurz vor der serienreifen Markteinführung. Das wird hohe Investitionen erfordern, aber die Klimabilanz der Landwirtschaft weiter verbessern.
Neue Stalltechnik gegen Methanausstoß
Gülle ist die Mischung aus Kot und Harn, die bei der Haltung der Tiere entsteht. Sie ist einerseits ein natürlicher Dünger. Andererseits entstehen bei ihrem Abbau Kohlendioxid, Ammoniak und Methan – also Klimagase. Durch Verbesserungen beim Stallbau können diese Emissionen deutlich reduziert werden. Allerdings bedeutet das große Investitionen, die nur beim Neubau von Ställen umgesetzt werden können.
Biogasanlagen für Energie
Viele Bauern betreiben eigene Biogasanlagen oder beliefern Kollegen mit Reststoffen für deren Anlagen. Biogas schafft Unabhängigkeit von Energieimporten und verbessert die Umweltbilanz. Gülle und Mist aus der Tierhaltung werden an Biogasanlagen geliefert. Dabei werden Methanemissionen durch den normalen Abbau der Gülle vermieden. Am Ende der Biogas-Herstellung entsteht übrigens natürlicher Dünger für Felder oder Gärten.
Hackschnitzel aus dem eigenen Wald
Viele Bauern bewirtschaften neben ihren Feldern eigene Waldflächen. Da liegt es nahe, dass viele Familien die Heizung auf Hackschnitzelbefeuerung umgestellt haben. Wärme aus dem eigenen Holz ist in der Energiebilanz emissionsärmer als Gas- oder Ölheizungen.
Optimierte Haltung, langes Leben
Experten betonen, dass im Sinne der Klimabilanz nicht die Milch-Höchstleistung das Ziel sei, sondern eine mittlere Milchleistung. Derzeit gibt es viele Forschungsprojekte im Hinblick auf die Fütterung und Haltung, mit dem Ziel einer nachhaltigeren, klimaschonenderen Milchwirtschaft. Wichtig ist auch, dass die Tiere ein langes gesundes Leben führen und am Ende als Fleischlieferant vermarktet werden. Das verbessert die Klimabilanz der Tierhaltung, weil die Tiere zweifach für unsere Ernährung genutzt werden.
Kuhwiesen für die CO2-Bindung
Im Milchviehstall entstehen Klimagase, vor allem Methan, das zu CO2 abgebaut wird. Zugleich sorgen die Landwirte für die effektive Bindung von Klimagasen. Denn für den Anbau des Grünfutters braucht es Grasland. Und das ist ein bedeutsamer CO2-Speicher. Gleiches gilt für die Weiden der Rinder und Kühe. Mit dem Rupfen und Fressen regen sie Wurzel- und Pflanzenwachstum an. Abgestorbene Wurzeln im Boden werden von Mikroorganismen und Regenwürmern zu Humus abgebaut, der dann zusätzlich CO2 speichert. Wenn Kühe und Rinder weiden, spart das aber auch Kraftstoff, weil dieses Futter weder gemäht noch eingebracht werden muss. Fachleute sagen, dass es in Zukunft immer wichtiger werden wird, die Bodenfruchtbarkeit zu fördern. Denn Grasland ist neben Feuchtgebieten und Mooren weltweit der größte Kohlenstoffspeicher. Erst dann folgen Wälder und Ackerland. Intakte Weiden sind zudem sehr effektive Wasserspeicher. Das wird bei den zunehmenden Starkregenereignissen als Folge des Klimawandels immer wichtiger.