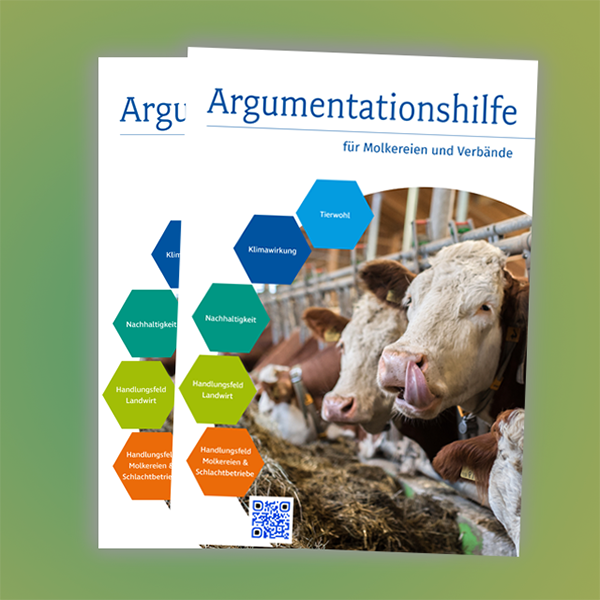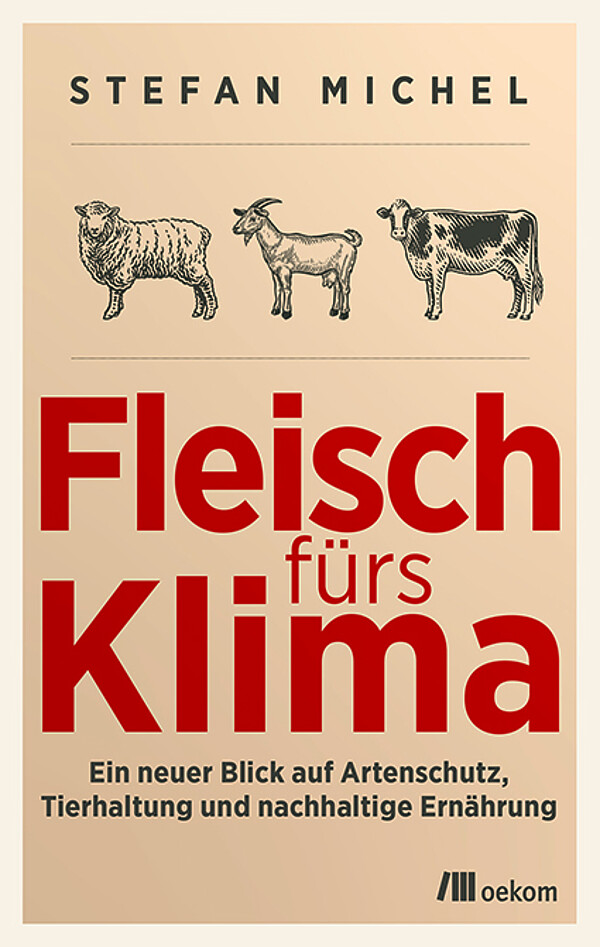Bayerische Milchbauern übernehmen Verantwortung. Mit nachhaltiger Bewirtschaftung, innovativen Technologien und dem Schutz von Böden und Gewässern tragen sie zum Erhalt unserer Umwelt bei. Das sind die Themen für eine nachhaltige Zukunft in der Landwirtschaft:

Euch fehlt ein Thema?