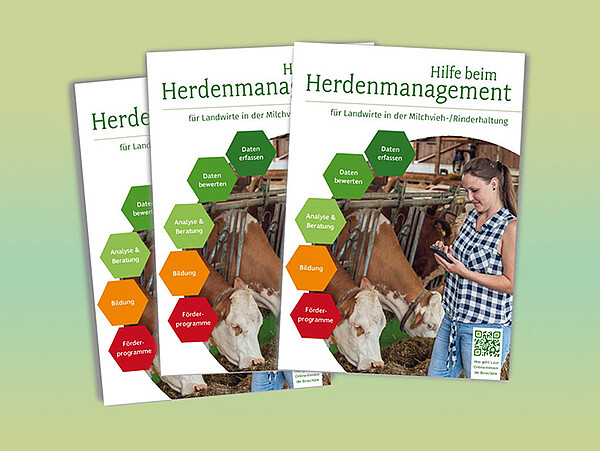Bayerns Milchbauern setzen verstärkt auf Tierwohl. Die überwiegende Zahl der bayerischen Kühe lebt in einem Laufstall. Sie finden hier Daten zu Agrarstruktur, Haltung und Milchleistung. Erfahren Sie auch alles zur Initiative Tierwohl des Handels mit den Labels und Haltungsstufen und ob sich Investitionen für Ihren Betrieb lohnen.

Die Initiative Tierwohl des Handels
Die Initiative Tierwohl des Handels